
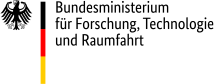
Wissenschaftskommunikation, Beteiligung vulnerabler Gruppen an Technikentwicklung, verantwortliche Nutzung von Künstlicher Intelligenz – das Themenspektrum der Jahreskonferenz 2025 des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Clusters Integrierte Forschung war breit gefächert und hoch aktuell.
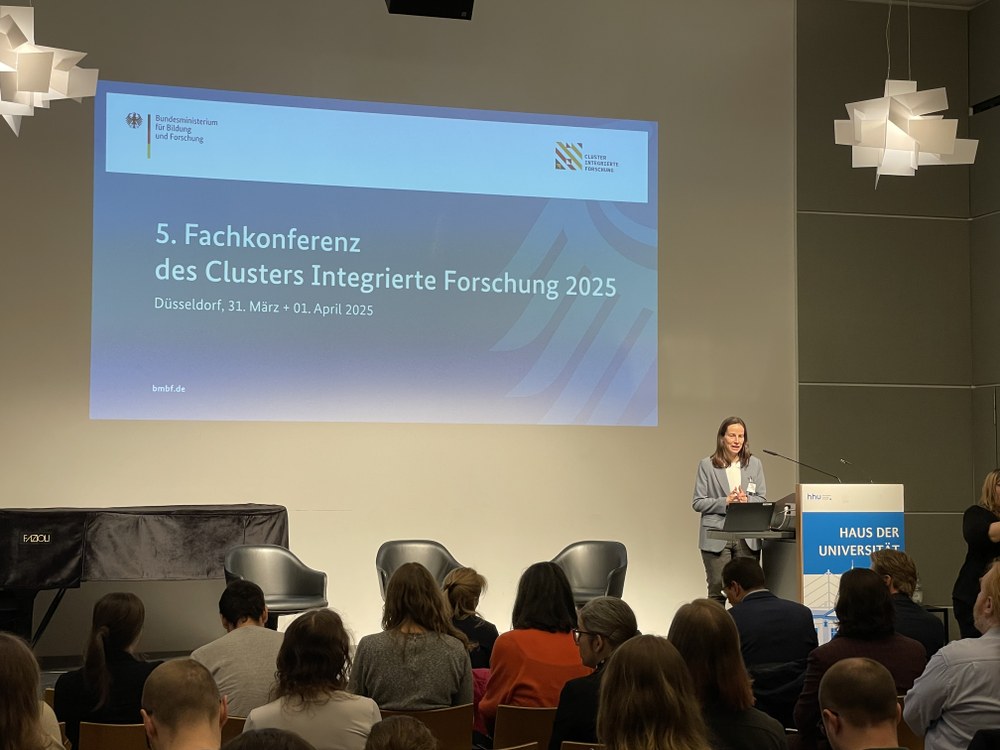
Wie kommuniziert man offen und zielgruppenrecht über Wissenschaft? Wie können sich vulnerable Gruppen an Forschung beteiligen? Wie gelingt es, Technikentwicklungsprojekte an demokratischen Werten und Normen auszurichten? Diese und viele weitere Fragen stellten sich etwa 50 Forschende, die Ende März 2025 im Haus der Universität in Düsseldorf zusammen kamen. Eingeladen hatte das BMBF-geförderte Cluster Integrierte Forschung zu seiner Jahreskonferenz.

Wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein – so der Titel der Keynote von Dr. Benedikt Fecher, Direktor von Wissenschaft im Dialog. Der Experte für Wissenschaftskommunikation ging in seinem Vortrag u. a. der Frage nach, wie man dafür sorgen könnte, dass Fakten in der Öffentlichkeit mehr Beachtung finden – besonders angesichts des Einflusses technologischer Plattformen und ihrer (KI-)Algorithmen. Seiner Meinung nach zeigten sich zwar Fortschritte bei der Öffnung wissenschaftlicher Diskurse hin zu neuen Formaten und stärkerer Beteiligung der Zielgruppen. Forschenden fehlten jedoch oftmals die Instrumente – und auch die Mittel – zur zielgruppenrechten Wissenschaftskommunikation.
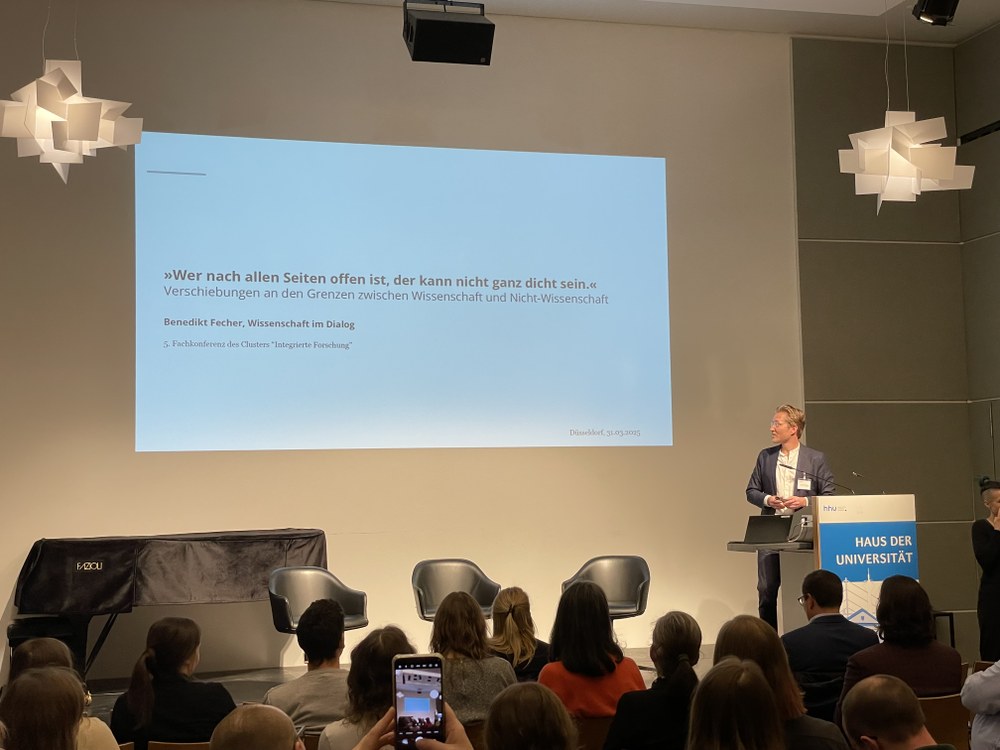
Dr. Barbara Neukirchinger und Bertold Scharf vom Projekt INPART moderierten eine Session mit Expertinnen und Experten, die Kinder, Jugendliche oder Menschen mit Behinderungen an ihrer Forschung beteiligt haben. Zu diesen Forschenden gehörten Dr. Anna Soßdorf von Science on the Move, Dr. Ann Christin Schulz, Daniel Krüger und Bastian Pelka von der TU Dortmund sowie Yousra El Makrini, Angélique Herrler und Freia De Bock von der HHU Düsseldorf. Alle Beteiligten waren sich einig, dass zum Projektstart genügend Zeit für das „Community Building“ mit den zu beteiligenden Gruppen eingeplant werden sollte. Zudem sei ein hohes Maß an Flexibilität im Forschungsprozess erforderlich, um integrative Projekte zum gewünschten Erfolg zu führen.
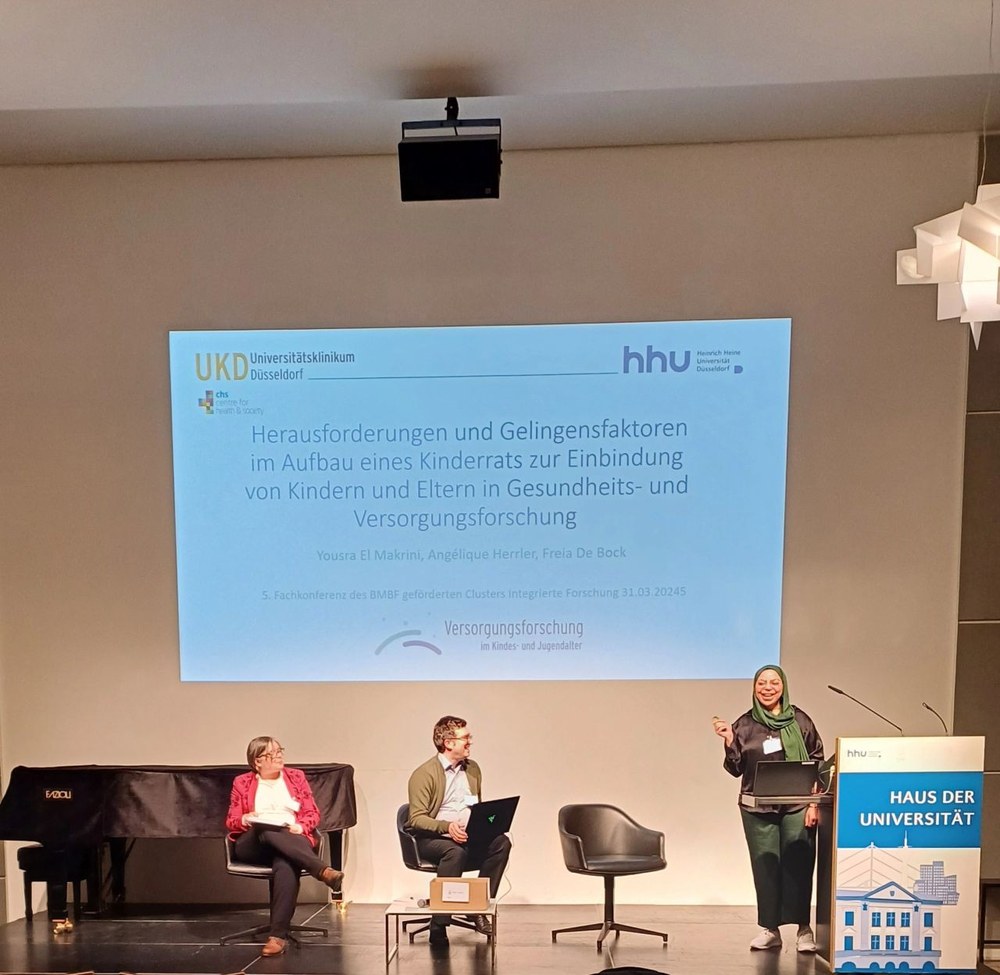
Interview mit Dr. Barbara Neukirchinger, Projekt INPART
Über die Frage, wie Partizipation an Technikentwicklungsprojekten gelingen kann, referierten Experten wie Prof. Dr. Christian Djeffal von der TU München, Dr. Daniel Guagnin vom nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung und Dr. Dennis Frieß von der HHU Düsseldorf. Das Fazit: Im Rahmen des „Legal Design“ können Juristinnen und Juristen nicht nur frühzeitig Feedback zu Chancen und Risiken der zu entwickelnden Technologien geben, sie können auch zu rechtlichen Aspekten wie Haftungsfragen oder Sorgfaltspflichten beraten. Hinter „Value Sensitive Design“ verbirgt sich die Idee, die eigenen Normen und Werte zu reflektieren, die (fast automatisch) in die Technikentwicklung einfließen. Herausforderung von co-creativen Forschungsprojekten ist die u. a. die wissenschaftliche Verwertbarkeit der erzielten Ergebnisse.

Den ausführlichen Nachbericht der Konferenz finden Sie hier.
Im Rahmen des Clusters Integrierte Forschung fördert das BMBF zurzeit fünf Projekte, die sich mit verschiedenen Aspekten der Technologieforschung beschäftigen:
• ANKER: Ethische Aspekte von KI in Forschungsprozessen verankern
• IndI: KI-Interventionen zur Verbesserung von Online-Diskursen
• INPART: Inklusive Partizipation an der Technologieentwicklung
• KIB: Künstliche Intelligenz und Bürgerbeiräte
• UWIGO: Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft optimieren
Über das Cluster Integrierte Forschung
Ausführlicher Nachbericht
Konferenzbericht
Website Cluster Integrierte Forschung