
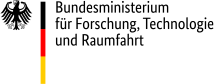
Am 4. Juni 2025 fand das virtuelle Vernetzungstreffen der Fördermaßnahme „DiKom – Die digitale Kommune“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) statt. Rund 60 Teilnehmende aus Forschung und kommunaler Praxis kamen zusammen, um über neue Wege digitaler Beteiligung zu diskutieren und erste Ergebnisse aus sieben geförderten Verbundprojekten vorzustellen.

Ziel der Fördermaßnahme DiKom ist es, kommunale Planungs- und Entscheidungsprozesse durch digitale Werkzeuge inklusiver, zugänglicher und demokratischer zu gestalten. Die Projekte erproben eine Vielzahl technischer Ansätze – von Augmented-Reality-gestützten Stadtteilrundgängen über gamifizierte Plattformen bis hin zu interaktiven Karten zur partizipativen Planung des Stadtraums. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger – insbesondere bislang unterrepräsentierte Gruppen wie Menschen mit einer Behinderung oder Kinder und Jugendliche – besser erreicht und aktiv in kommunale Planungsvorgänge eingebunden werden können. Die digitalen Formate verstehen sich dabei nicht als Ersatz, sondern als sinnvolle Ergänzung zu bestehenden analogen Beteiligungsverfahren.
Die Veranstaltung wurde eröffnet durch eine Keynote von Frau Prof. Dr. Heidi Sinning (Fachhochschule Erfurt) und Sebastian Hampf (Stadt Rostock), die Ergebnisse aus dem inzwischen abgeschlossenen BMFTR-Projekt XR-Part vorstellten. Im Fokus von XR-Part stand die Erforschung und Erprobung von zwei XR-Beteiligungsformaten: eine interaktive AR-Beteiligungstour durch reale Stadtteile sowie ein virtueller Beteiligungsraum im Metaversum. Beide Formate ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, Stadtgestaltung zu visualisieren, zu kommentieren und somit selbst mitzugestalten. Sie können beispielsweise digitale Objekte auf einer interaktiven Oberfläche platzieren oder per Texteingabe auf digitalen Planungsunterlagen Vorschläge für die Bebauung hinterlassen.
Neben positiven Rückmeldungen zu den beiden entwickelten Beteiligungsformaten, besonders in Bezug auf Anschaulichkeit und Nutzerfreundlichkeit, betonten Frau Prof. Dr. Sinning und Herr Hampf auch Herausforderungen, mit denen die Forschenden umgehen mussten. In diesem Zusammenhang nannten sie Zugangshürden, technische Akzeptanz und einen hohen Moderationsbedarf. Insgesamt zeigten sich somit viele Parallelen zu den in DiKom zu erforschenden Fragen nach Qualität, Wirkung und Verantwortung digitaler Beteiligung.
In den darauffolgenden Projektpräsentationen stellten die insgesamt sieben DiKom-Verbundprojekte ihren jeweiligen Arbeitsstand vor. Dabei wurde die Vielseitigkeit der Ansätze deutlich: So entwickelt beispielsweise das Projekt DeineStadt ein interaktives Simulationsspiel auf Basis eines digitalen Zwillings der Stadt München, das Jugendliche durch spielerische Entscheidungen für urbane Planungsprozesse sensibilisieren soll. Aktuell liegt der Fokus auf der Verknüpfung von Gameplay-Elementen mit realen Planungsparametern sowie auf der Frage, wie aus dem Spielverlauf aussagekräftige Daten für die Stadtentwicklung gewonnen werden können.
Das Projekt DiKomAll konzentriert sich hingegen auf die Entwicklung von Beteiligungswerkzeugen in leichter Sprache sowie mit symbolgestützter Bedienung, die insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten adressieren. Derzeit wird gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern an der nutzerfreundlichen Gestaltung gearbeitet; erste Testphasen mit Zielgruppenpartnerinnen und -partnern haben wichtige Impulse zur weiteren Anpassung geliefert.
Das Projekt KoodiKo untersucht, wie digitale Beteiligung in kooperativen Planungsprozessen zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft verankert werden kann. Im Fokus steht dabei die Entwicklung eines partizipativen Werkzeugs zur co-kreativen Entscheidungsfindung – mit besonderem Blick auf raumbezogene Transformationsprozesse. Aktuell arbeitet das Projekt an der Integration qualitativer und quantitativer Beteiligungsdaten in digitale Planungsgrundlagen, etwa durch interaktive Karten oder datengestützte Dialogformate. Ziel ist es, sowohl Fachverwaltungen als auch Bürgerinnen und Bürger in einem gemeinsamen digitalen Raum zusammenzubringen – nicht nur zur Meinungsäußerung, sondern zur echten Aushandlung. Dabei spielen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Verantwortungsstrukturen eine zentrale Rolle.
Weitere Informationen zu den DiKom-Projekten finden Sie hier.
Beteiligung auseinander und tauschten ihre Erfahrungen aus. In Workshop 1 ging es grundsätzlich um Partizipation und die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Umsetzung co-kreativer Prozesse und dem Erreichen unterschiedlicher Zielgruppen. Diskutiert wurde unter anderem, wie Beteiligungsprozesse so gestaltet werden können, dass sie auch für bisher unterrepräsentierte Gruppen zugänglich sind – etwa durch niedrigschwellige Angebote, persönliche Ansprache und passgenaue Formate. In Workshop 2 ging es um Fragen zur nachhaltigen Verwendung der Projektergebnisse bzw. der Verstetigung. Viele Projekte haben hier mit begrenzten Ressourcen, rechtlichen Unsicherheiten oder strukturellen Barrieren zu kämpfen. Jedoch kann durch die Kombination von klaren Zielsetzungen mit einer frühen Einbindung der Verwaltung ein echtes Potenzial für die Verstetigung entstehen. In Workshop 3 wurden technische Aspekte wie intuitive Bedienbarkeit, Datenschutz oder die Integration in bestehende IT-Strukturen intensiv beleuchtet.
Der Tag verdeutlichte: Digitale Technologien haben das Potenzial, nicht nur neue Zugänge für Bürgerbeteiligung zu schaffen, sondern auch zur dauerhaften Weiterentwicklung demokratischer Beteiligung beizutragen – vorausgesetzt, sie werden mit Augenmaß und Offenheit umgesetzt.
Die Forschenden werden voraussichtlich Ende 2026 zu einem Abschlusstreffen zusammenkommen und dann ihre Forschungsergebnisse präsentieren.