

Partizipative Forschung in der Gesundheit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Durch die Beteiligung der zu beforschenden Zielgruppe können lebensweltnahe, praxisorientierte Ergebnisse generiert und Veränderungen angestoßen werden. Bei vulnerablen Gruppen und komplex behinderten Menschen stößt partizipative Forschung an ihre Grenzen. Dazu sprachen wir mit Dr. Caren Keeley von der Universität zu Köln.

Frau Dr. Keeley, warum ist partizipative Forschung im Bereich von Pflegeinnovationen besonders wichtig?
Technikentwicklung in der Pflege hat unter anderen das Ziel, Nutzende zu entlasten, zu unterstützen, zu befähigen usw. Dafür ist es wichtig, die Perspektive der Nutzenden zu kennen. Partizipative Forschung macht es möglich, sich mit ihnen gemeinsam auf den Weg zu machen, die Qualität von (Technik-)Entwicklung zu erforschen, zu bewerten und aus der subjektiven Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer zu ergänzen und zu optimieren. Der Mensch sollte als Nutzer von Prozessen der Technikentwicklung in diese involviert sein – dazu bietet sich partizipative Forschung an.
Wo liegen die Herausforderungen - und vielleicht auch Grenzen – für teilhabeorientierte Forschung im Bereich der Pflege von Menschen mit komplexen Behinderungen?
Eine teilhabeorientierte Forschung in der Pflege bezieht die Menschen als Experten ihrer selbst in alle Prozesse der Erforschung ihrer Lebenswelt mit ein. Ausgehend von den individuellen Möglichkeiten, werden Prozesse so gestaltet, dass die Teilnehmenden daran teilhaben und ihre subjektiven Perspektiven äußern können. Grenzen erfährt dieses Vorhaben, wenn Menschen über keine bzw. sehr geringe verbalsprachliche Möglichkeiten und eingeschränkte kognitiv-reflexive Fähigkeiten verfügen, wie es bei Menschen mit komplexen Behinderungen in der Regel der Fall ist. Wenn ein Austausch nicht durch einen Dialog auf unsere reguläre verbalsprachliche Art erfolgen kann, dann sehen wir uns als Forschende und Unterstützende im Verstehen herausgefordert. Es ist dann Aufgabe und Auftrag der forschenden Person, verlässliche und innovative Zugangsmöglichkeiten zu schaffen, um ein beiderseitiges Verstehen so weit wie möglich zu garantieren und auf diese Weise eine möglichst große Teilhabeorientierung auch in Forschungsprozessen zu gewährleisten.
Was sind Faktoren, die bei den Methoden berücksichtigt werden müssen, um erfolgreich vulnerable Menschen partizipieren zu lassen?
Abgesehen von den Möglichkeiten einer unterstützten Kommunikation durch elektronische oder körpereigene Hilfsmittel, sind es tatsächlich eher die Lebensumstände, die bei der Gestaltung von möglichen Methoden Berücksichtigung finden müssen. So zeigen sich bei Menschen mit komplexen Behinderungen immer wieder Lernprozesse, die dazu führen, dass sie gar nicht in der Lage sind, eine eigene Entscheidung zu treffen oder zu äußern, sich eine Meinung zu bilden oder Wünsche und Interessen zu haben. Lebensprägende Erfahrungen der permanenten Unterstützung können zu einer so genannten „erlernten Bedürfnislosigkeit“ nach Theunissen oder „erlernten Hilflosigkeit“ nach Seligman führen. Wenn ich nie die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, eigenständig mit Technikunterstützung zum Beispiel auf einem Pferd zu sitzen, dann entwickle ich unter Umständen auch nicht die Wunsch-Perspektive dazu. Bei der Gestaltung einer teilhabeorientierten Forschung müssen diese Kontexte immer mitgedacht werden. Das heißt, dass bei der Entwicklung geeigneter Methoden neben den kommunikativen Verständigungsmöglichkeiten vor allem auch Erfahrens- und Erlebensmöglichkeiten mitgedacht werden müssen.
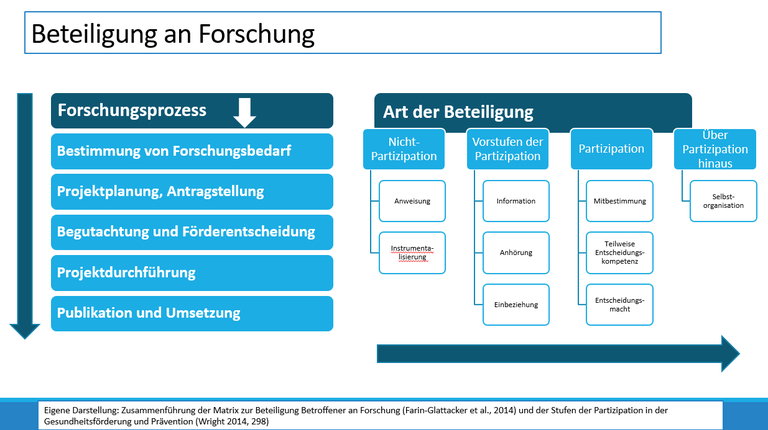
Wie gehen Sie konkret vor? Welche Methoden und Tools können Sie empfehlen?
Bei einer teilhabeorientierten Forschung ist es notwendig, die teilnehmenden Personen zunächst kennen zu lernen, um alle anderen Entwicklungen an die persönlichen Möglichkeiten anzupassen. Dies tun wir durch direkten Kontakt, aber auch durch die Befragung nahestehender Bezugspersonen. So erfahren wir, wie die Person kommuniziert, wie sie zum Beispiel Zustimmung und Ablehnung ausdrückt. Wir erfahren ihre Interessen und Vorlieben und haben Einblick in ihre Lebenswelt. Um die Person konkret zu beteiligen, braucht es diese Kenntnisse. Sie fließen in die Entwicklung der Methoden ein, die immer multimodale und multisensorische Kommunikationsmöglichkeiten, angepasst an die individuellen Möglichkeiten, berücksichtigen sollten. Hilfreich können auch gemeinsame Aktivitäten sein, in denen sich aktiv und handelnd mit einer bestimmten Fragestellung auseinandergesetzt wird. Aus dem Repertoire bestehender Forschungsmethoden können sich bildgebende Verfahren eignen, wie zum Beispiel Photo Voice. Bei dieser Methode macht die Person mit Unterstützung von Bildern ihre Sicht auf bestimmte Fragen deutlich. Auch die Methode Talking Mats, die aus dem Bereich der unterstützten Kommunikation stammt, kann ggf. eingesetzt werden. Hier handelt es sich um eine „Befragung“, bei der über die Auswahl von Piktogrammkarten eine Entscheidung getroffen und kommuniziert wird. Grundsätzlich sehe ich eine große Chance in der Zusammenführung interdisziplinärer Perspektiven und Zugänge. So zeigen sich gewinnbringende Ansätze in der Pädagogik – zum Beispiel persönliche Zukunftsplanung - oder Diagnostik – zum Beispiel die EDAAP-Skala zur Schmerzerfassung -, die angepasst, auch im Kontext von Forschungsvorhaben zur Anwendung kommen können.
Was ist Ihre Vision künftiger partizipativer Forschung mit Menschen mit Behinderung?
Nicht jede Form von Forschung muss partizipativ gestaltet sein. Wenn aber die Meinung, Einstellung, Sichtweise adressierter Personenkreise relevant ist - und dies sollte es vor allem bei Fragen der Lebensqualität sein -, dann sollten die Personen selbst in Forschungsprozesse mit einbezogen werden. Diese gilt es dann so zu gestalten, dass jede Person in der Lage ist, sich einzubringen und ihre subjektive Sichtweise auszudrücken. Hierfür sind weiterhin interdisziplinäre Entwicklungen hinsichtlich einer methodischen Gestaltung notwendig. Partizipative Forschung benötigt zudem zusätzliche Ressourcen, die in der Regel auch bereits vor dem offiziellen Projektbeginn zum Einsatz kommen müssen. Die Ermittlung von Fragen aus Perspektive der Personen selbst, die Ermittlung ihrer Möglichkeiten, Bedürfnisse und Bedarfe hinsichtlich einer Forschungsbeteiligung und die teilhabeorientierte Gestaltung des gesamten Prozesses sind Aspekte, die noch wenig Berücksichtigung finden. Hier gilt es auch strukturelle Veränderungen der Forschungslandschaft und -förderung weiter anzugehen. Jeder Schritt in Richtung einer partizipativen Forschung ist für die Teilhabe von Menschen mit komplexen Behinderungen äußerst bedeutend und daher unverzichtbar.
Weitere Informationen:
Grünbuch Partizipation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
Das Interview wurde im Oktober 2022 geführt.